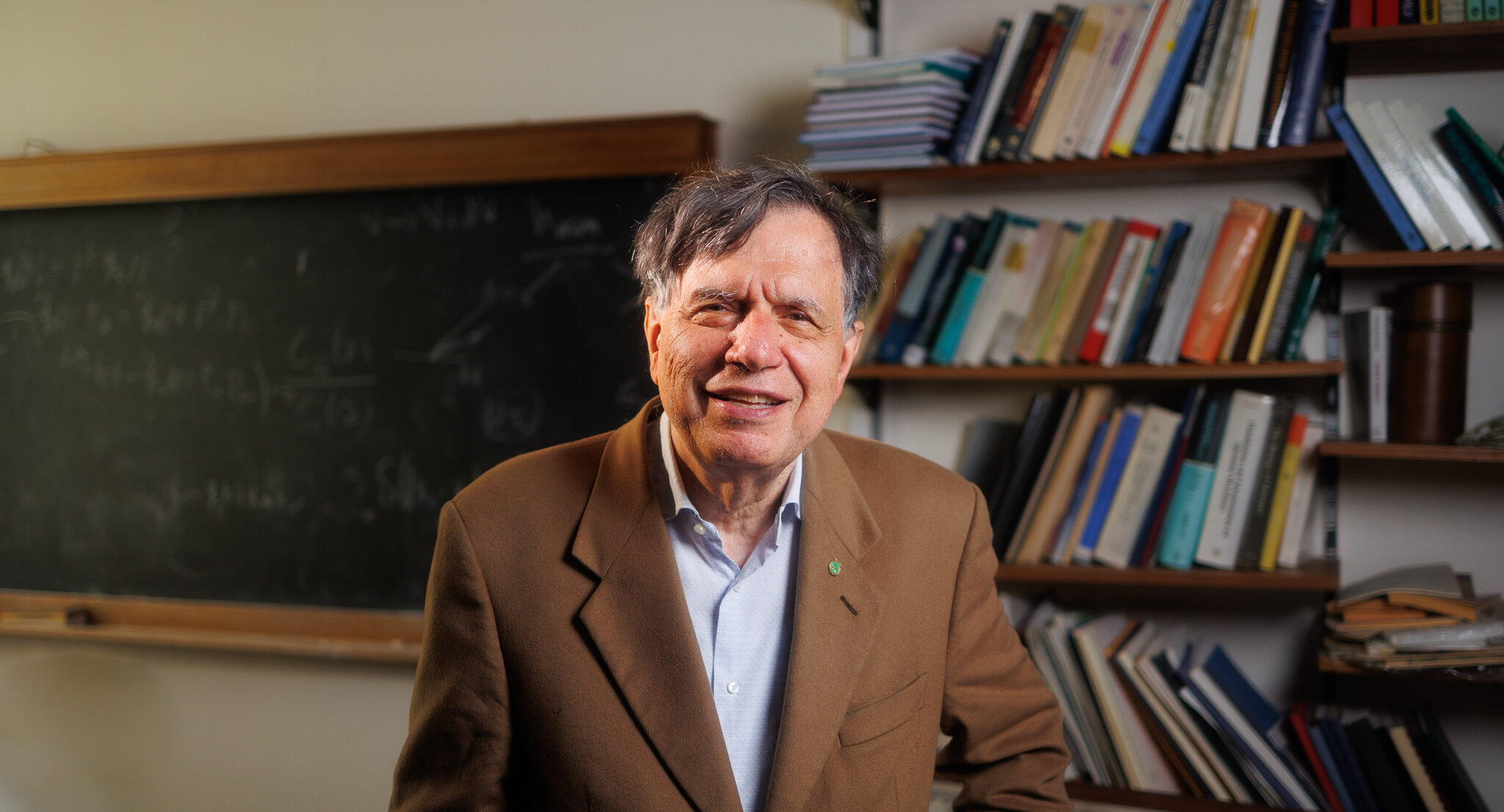Articolo di Giorgio Parisi, presidente del comitato tecnico-scientifico istituito dal Ministero per l’Università e la Ricerca (MUR) a sostegno della candidatura italiana a ospitare l’Einstein Telescope.
Tagesspiegel, 30/09/25
I ricercatori vogliono capire l’origine dell’universo misurando le onde gravitazionali. Il rilevatore necessario a tale scopo dovrebbe essere costruito in Sassonia e in Sardegna. A sostenerlo è il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi.
Già nel 1916 Albert Einstein aveva previsto l’esistenza delle onde gravitazionali, prodotte dall’accelerazione di grandi masse come i buchi neri. Tuttavia, solo nel settembre 2015 il rilevatore LIGO è riuscito a rilevarle per la prima volta Una scoperta che nel 2017 è stata premiata con il premio Nobel per la fisica.
Ora si prevede di costruire un nuovo rilevatore molto più preciso, l’Einstein Telescope. Questo osservatorio sotterraneo, che sarà in grado di catturare le onde gravitazionali e consentire una migliore esplorazione dell’universo, è una delle iniziative più promettenti nella ricerca di base. L’ambizioso progetto consentirà agli scienziati di esplorare la storia cosmica fin dalle sue origini, comprendere i fenomeni astrofisici più complessi e sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate.
Grazie al suo eccezionale potenziale innovativo, nel luglio scorso il progetto è stato inserito dal governo federale tedesco nella short-list dei nove progetti scientifici prioritari, selezionati tra 32 proposte. Con questa scelta, la Ministra federale della ricerca Dorothee Bär ha sottolineato in modo molto chiaro la rilevanza scientifica, economica e sociale del progetto a livello nazionale.
Questa decisione apre ora la strada a un’opportunità unica di collaborazione tra Germania e Italia. Entrambi i Paesi vantano una lunga tradizione di eccellenza scientifica e sono in grado di sostenere a lungo termine un progetto di così grande portata.
L’Italia propone di ospitare l’osservatorio nel sito di Sos Enattos, in Sardegna: un territorio che presenta caratteristiche tecniche oggettivamente ideali. Il Paese vanta inoltre una leadership europea consolidata nella ricerca sulle onde gravitazionali – ospitando l’unico interferometro europeo, EGO-Virgo, a Pisa – e nella costruzione di laboratori sotterranei (basti pensare al Gran Sasso), oltre a una lunga esperienza in settori chiave quali meccanica, criogenia, ottica, elettronica e robotica.
Con un investimento finanziario già assicurato di 1,3 miliardi di euro e un forte sostegno istituzionale, l’Italia si candida seriamente a ospitare l’Einstein Telescope e propone una collaborazione di alto livello con la Germania per la realizzazione dell’infrastruttura su due siti gemelli, in Sardegna e in Sassonia.
La soluzione tecnicamente migliore
Questa configurazione a due bracci separati (2L) è ritenuta dalla comunità scientifica internazionale la soluzione più idonea dal punto di vista tecnico, finanziario e della gestione dei rischi. La Sassonia, pur avendo presentato di recente la sua candidatura a ospitare il sito, offre caratteristiche geofisiche ideali per questa collaborazione, una comunità scientifica consolidata e il pieno supporto istituzionale della regione, favorevole a una collaborazione con l’Italia.
Per la Germania, partecipare all’Einstein Telescope, con la realizzazione di uno dei due strumenti in Sassonia, rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare il proprio ruolo nella ricerca sulle onde gravitazionali, adottando una soluzione più sicura dal punto di vista tecnico e generando nuove prospettive di sviluppo tecnologico ed economico. La Sassonia, con un PIL pro capite inferiore alla media nazionale, potrebbe beneficiare in modo significativo dal progetto, che può diventare un catalizzatore di crescita, occupazione e innovazione per la regione.
Una collaborazione italo-tedesca nella realizzazione dell’Einstein Telescope permetterebbe di creare un progetto europeo di grande respiro, coinvolgendo non soltanto Germania e Italia, ma anche Paesi confinanti come Polonia e Repubblica Ceca. Permetterebbe di rafforzare il legame scientifico e tecnologico tra questi quattro Paesi, valorizzare gli investimenti già realizzati e creare nuove opportunità di sviluppo per aree dell’Europa che attendono un rilancio economico e sociale. ET non è solo un’opportunità per la scienza, ma anche un motore di crescita.
In un’epoca di crescente competizione globale nella scienza e nella tecnologia, unire le forze su un progetto di questa portata non è solo auspicabile, ma necessario. Con Einstein Telescope, Nord e Sud Europa potrebbero unire le forze, consolidando la leadership scientifica e l’autonomia strategica dell’Europa. Lavorare insieme oggi significa costruire il futuro, rafforzare l’innovazione e creare opportunità per le generazioni future.
Di seguito la versione originale in tedesco:
Mit der Messung von Gravitationswellen will die Forschung die Entstehung des Universums verstehen. Der dafür nötige Detektor soll in Sachsen und auf Sardinien entstehen. Dafür plädiert Physik-Nobelpreisträger Giorgio Parisi.
Schon 1916 hatte Albert Einstein die Existenz von Schwerkraftwellen, ausgelöst durch die Beschleunigung großer Massen, wie etwa Schwarze Löcher, vorhergesagt. Doch erst im September 2015 konnte der LIGO-Detektor diese Gravitationswellen erstmals nachweisen. Eine Entdeckung, die 2017 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde.
Nun soll ein neuer, wesentlich präziserer Detektor gebaut werden, das Einstein-Teleskop. Dieses unterirdische Observatorium, das Gravitationswellen auffangen und eine bessere Erforschung des Universums ermöglichen soll, gehört zu den vielversprechendsten Initiativen in der Grundlagenforschung. Das ehrgeizige Projekt wird es Forschenden ermöglichen, die kosmische Geschichte von ihren Ursprüngen an erforschen, die komplexesten astrophysikalischen Phänomene verstehen und fortschrittliche technologische Lösungen entwickeln zu können.
Wegen seines außergewöhnlichen Innovationspotenzials wurde das Projekt im Juli von der deutschen Bundesregierung in die Shortlist der neun vorrangigen wissenschaftlichen Vorhaben aufgenommen, ausgewählt aus zweiunddreißig Vorschlägen. Mit dieser Vorauswahl hat Bundesforschungsministerin Dorothee Bär die nationale wissenschaftliche, wirtschaftliche und soziale Bedeutung des Projekts sehr deutlich hervorgehoben.
Diese Entscheidung eröffnet nun eine einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien. Beide Länder blicken auf eine lange Tradition wissenschaftlicher Höchstleistungen und sind in der Lage, ein Projekt dieser Größenordnung langfristig zu unterstützen.
Italien schlägt vor, das Observatorium am Standort Sos Enattos auf Sardinien zu errichten, wo objektiv betrachtet ideale technische Voraussetzungen gegeben sind. Zudem verfügt das Land mit dem einzigen europäischen Interferometer in Pisa, dem EGO-Virgo, europaweit über eine gefestigte Führungsposition im Bereich der Gravitationswellenforschung sowie beim Bau von unterirdischen Laboren, man denke nur jene im Gran Sasso. Darüber hinaus besitzt Italien langjährige Erfahrung in Schlüsselbereichen wie Mechanik, Kryotechnik, Optik, Elektronik und Robotik.
Mit einer bereits gesicherten Finanzierung von 1,3 Milliarden Euro und starker institutioneller Unterstützung bewirbt sich Italien nachdrücklich als Standort für das Einstein-Teleskop und schlägt eine hochwertige Zusammenarbeit mit Deutschland für den Bau der Infrastruktur an zwei Partnerstandorten in Sardinien und Sachsen vor.
Technisch beste Lösung
Diese Anordnung mit zwei getrennten Armen (2L) wird von der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft als die technisch, finanziell und risikomanagementtechnisch am besten geeignete Lösung angesehen. Sachsen hat sich zwar erst kürzlich als Standort beworben, bietet jedoch ideale geophysikalische Eigenschaften für diese Zusammenarbeit, eine etablierte Wissenschaftsgemeinschaft und die volle institutionelle Unterstützung des Landes, das eine Zusammenarbeit mit Italien befürwortet.
Für Deutschland stellt die Beteiligung am Einstein-Teleskop mit der Errichtung eines der beiden Arme in Sachsen eine strategische Chance dar, seine Rolle in der Gravitationswellenforschung zu stärken, eine aus technischer Sicht sichere Lösung zu wählen sowie neue Perspektiven für die technologische und wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Sachsen, dessen Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt unter dem Bundesdurchschnitt liegt, könnte erheblich von dem Projekt profitieren. Das Einstein-Teleskop könnte sich zu einem Katalysator für Wachstum, Beschäftigung und Innovation in der Region entwickeln.
Infolge einer italienisch-deutschen Zusammenarbeit bei der Realisierung des Einstein-Teleskops könnte ein umfangreiches europäisches Projekt entstehen, an dem nicht nur Deutschland und Italien, sondern auch Nachbarländer wie Polen und die Tschechische Republik mitwirken könnten. Es könnte die wissenschaftlichen und technologischen Beziehungen zwischen diesen vier Ländern stärken, bereits getätigte Investitionen weiter ergänzen und neue Entwicklungschancen für Regionen Europas schaffen, die auf einen wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung warten. Das Einstein-Teleskop ist nicht nur eine Chance für die Wissenschaft, sondern auch ein Wachstumsmotor.
In einer Zeit des zunehmenden globalen Wettbewerbs in Wissenschaft und Technologie ist eine Bündelung der Kräfte für ein Projekt dieser Größenordnung nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Mit dem Einstein-Teleskop könnten Nord- und Südeuropa ihre Kräfte vereinen und so die wissenschaftliche Führungsrolle und die strategische Autonomie Europas festigen. Heute gemeinsam zu handeln bedeutet, die Zukunft zu gestalten, Innovation zu stärken und Chancen für künftige Generationen zu schaffen.